
Zeigen, was man hat! – Neuer Slogan schärft das Profil.
Licht, Luft Leibertingen! Der erste Bürgermeister der Gesamtgemeinde, Heinrich Güntner, prägte das Leitbild der Gemeinde mit diesen Worten. Wie recht er doch bereits damals hatte!


Bürgermeister

Hauptamtsleiter

Stabstelle Kinderhäuser
Personalamt

Bürgerbüro

Sekretariat BM
Geschäftsführung Bioenergie Leibertingen GmbH
ELR Anträge
Tourismus

Amtsblatt

Licht, Luft Leibertingen! Der erste Bürgermeister der Gesamtgemeinde, Heinrich Güntner, prägte das Leitbild der Gemeinde mit diesen Worten. Wie recht er doch bereits damals hatte!
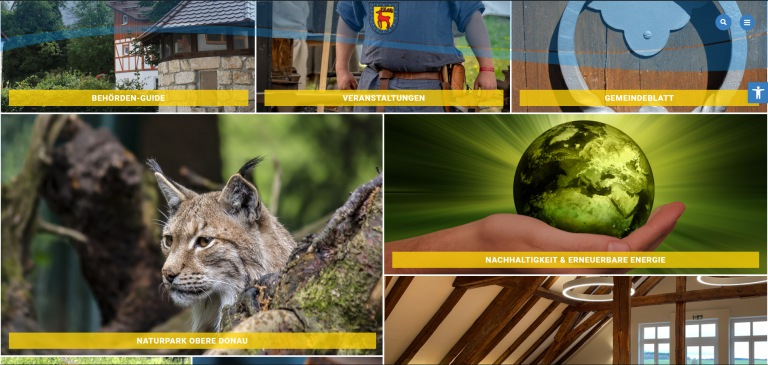
Einhergehend mit dem neuen Logo der Gemeinde wird es Zeit, sich nach außen so zu zeigen, wie die Gemeinde ist! Lebenswert! Liebenswert! Charakterstark! Individuell! Vorzeigbar!

Mit Ablauf des Jahres 2022 war die Erfüllung des Online-Zugangs-Gesetzes für alle Gemeinden Pflicht. Aufgrund der Fülle der Arbeiten und teilweise noch fehlender Vorarbeiten konnten

Wirtschaftsförderung hat viele Facetten. Zum einen kann ein Unternehmen der Gemeinde dieses mittels „Microhomepage“ auf der Gemeindeseite bewerben und auch auf die eigene Homepage verlinken.

Die Netze BW und die Gemeinde Leibertingen starten in eine neue Phase der bürgernahen Kommunikation. Auf einer gemeinsam entwickelten Seite bietet die Netze BW alle

Die Verwaltung der Gemeinde stellt sich neu auf. Das bestehende Dokumentenmanagementsystem stellt die ideale Grundlage für die Digitalisierung dar. Erweitert um:
Die Gemeindereform 1975 hat aus den zuvor vier selbständigen Gemeinden Altheim, Kreenheinstetten, Leibertingen und Thalheim eine neue Gemeinde geformt. Das hört sich so ganz einfach an und ist vielleicht auch nur aus der Distanz der Jahre so leicht hin zu sagen. In der Zeit des Entstehens wurde vieles, was mit dieser Neubildung zusammenhing, sehr emotional behandelt. Zum 01.01.1975 hörten per Gesetz die bereits erwähnten selbständigen Gemeinden auf zu bestehen und die über den Zusammenschluss abgefassten Vereinbarungen erhielten Rechtskraft.
Bürgermeister Otto Martin aus Altheim, Anton Utz aus Kreenheinstetten, Erwin Wohlhüter aus Thalheim waren so die ersten Ortsvorsteher ihrer Ortschaften, die vereinbarungsgemäß mit der Ortschaftsverfassung ausgestattet, in die zunächst mit dem vorläufigen Namen Leibertingen versehene Gemeinde eingingen. Bürgermeister Franz Riester, Leibertingen, wurde zum Amtsverweser für diese neue kommunale Vereinigung bestellt. Im Übergangsgemeinderat waren die Mitglieder aller vier bis dahin selbständigen Gemeinderatsgremien vereinheitlicht worden.
Die hauptamtliche Stelle des Bürgermeisters für diese neu gebildete Gemeinde mit ihren damals etwa 1.830 Einwohnern wurde im zeitigen Frühjahr ausgeschrieben. Einziger Bewerber war der frühere Bürgermeister und damalige Ortsvorsteher der nahe gelegenen Ortschaft Vilsingen, Heinrich Güntner. Er wurde mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt und lenkte
dann auch 24 Jahre lang, bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1999, die Geschicke der Gemeinde.
Ab 1999 bis 2021 war Armin Reitze Bürgermeister der Gemeinde Leibertingen. In dieser Zeit wuchs und gedieh die Gemeinde zunehmends.
Seit 2021 und bis zum heutigen Tag ist Bürgermeister Stephan Frickinger für die Gesamtgemeinde Leibertingen zuständig und bringt neue Projekte auf
den Weg. Auch nach knapp 50 Jahren Gesamtgemeinde Leibertingen hat sich diese Tradition seiner Vorgänger nicht geändert.


Altheim ist der am südlichsten gelegene und kleinste Ortsteil der Gemeinde Leibertingen. Erstmals ist Altheim im Jahre 768 erwähnt.
Als Ortsadel wird 1241 ein Soldat (Ritter) Heinrich von Altheim genannt. Die nahe Römerstraße und römische Ansiedlungen, ebenso wie auf vorrömische Zeiten hindeutende Grabfunde, beweisen eine Ansiedlung von Altheim seit langen Jahrhunderten.
Altheim befand sich im 8. Jahrhundert im Besitz des Klosters St. Gallen/Schweiz, vom 11. Jahrhundert an im Besitz des Klosters St. Georgen und seit dem 15. Jahrhundert im Besitz der Herren von Zimmern, von 1488 an im Besitz der Herrschaft Meßkirch, bis das Dorf 1534 durch Tausch an das Haus Österreich gelangte.
Im 18. Jahrhundert verlieh das Haus Österreich die Ortschaft den Grafen Schenk von Castel, zu deren Herrschaft Gutenstein und auch die Dörfer Ablach und Engelswies zählten.
Während die Herrschaft Gutenstein zugleich auch die Grund- und Niedergerichtsherrschaft ausübte, war das Haus Österreich aber Landesherr und überließ die Grafenrechte den Grafen von Sigmaringen. Bis 1806 war Altheim österreichisch, von 1806 bis 1810 württembergisch und von da an badisch. Verwaltet wurde Altheim seit 1813 vom Bezirksamt Meßkirch, von 1824 an vom Bezirksamt Pfullendorf, von 1828 an vom Bezirksamt Stetten a.k.M., um 1842 wieder an das Bezirksamt Meßkirch überzugehen. Nach Aufhebung des Bezirksamtes Meßkirch im Jahre 1936 wurde Altheim vom Bezirksamt und später Landkreis Stockach verwaltet. Seit 1973 gehört Altheim zum Landkreis Sigmaringen.
Früher war Altheim eine eigene Pfarrei. 1265 wird ein Plebanus (Leutpriester) „de Altheim“ genannt. 1345 wird von einem Pankratius-Gotteshaus zu Altheim geschrieben. Wahrscheinlich ist die Pfarrei mangels der Substentationsmittel im 30-jährigen Krieg untergegangen. Die Kirche in Altheim ist ein Kleinod, in dem besonders der Hochaltar mit der barocken Marienkönigin und das 1977 neu geschaffene Geläute erwähnt werden müssen. Die unter umfangreicher Beteiligung der Bevölkerung durchgeführte Renovation läßt seit einiger Zeit das Dorfkirchlein in neuem Glanz erstrahlen. Die Zimmersche Chronik weiß davon zu berichten, daß vor langer Zeit Wallfahrten hierher stattfanden.</p
Kreenheinstetten wird in einer Urkunde des Grafen Perathold, die sich im Stiftsarchiv von St. Gallen befindet, im Jahre 793 mit der Ortsbezeichnung Hohundsteti erstmals urkundlich erwähnt. Auf eine Besiedlung in der Keltenzeit weisen fünf Grabhügel im „Straßenhau“, einem Waldstück zwischen Kreenheinstetten und Langenhart, hin. Vorgefundene Siedlungsreste weisen auf die Hallstattzeit (800 – 450 v. Chr.) hin.
Der Ortsname Kreenheinstetten ist bis heute nicht klar gedeutet. Der Vorsatz „Krayen“ scheint erst im Anfang des 12. Jahrhunderts hinzugekommen zu sein. Vielleicht kommt „Kreen“ von „Grune“ = hochgelegene Stätte, oder von „Krayen“, weil die Herren von Hohenkrähen den Ort einmal besessen haben sollen.
Die Erforschung der Ortsgeschichte wird dadurch erschwert, daß im Jahre 1445 bei einer Fehde zwischen Josef Suerhoefel von Buchhorn und Hans von Bubenhofen ersterer ganz Kreenheinstetten durch Brand zerstören ließ (nur der Turm blieb erhalten), wobei alle Urkunden verloren gingen.
Dennoch ist anzumerken, daß bei den Nachforschungen des aus Anlaß der 1200-Jahrfeier erarbeiteten Buches „Im Schatten eines Denkmals“ festgestellt wurde, daß über unseren Ort Kreenheinstetten umfangreiche Archivalien vorliegen. Vieles wurde in dem genannten Buch verwendet. Zu Zeiten der Erbauung von Kreenheinstetten gehörte dieses wahrscheinlich den Herren von Wagenburg auf dem Schloßfelsen. Später waren die Herren von Zimmern von 1516 – 1595 und die Herren von Fürstenberg von 1626 – 1806 die Besitzer. Im Jahre 1806 wurde Kreenheinstetten badisch.
Bekannt wurde Kreenheinstetten durch seinen berühmten Sohn Abraham a Santa Clara (1644 – 1709). Der wortgewaltige kaiserliche Hofprediger zu Wien war für seine urwüchsige, kernige und treffsichere Sprache bekannt. Im heutigen Gasthaus „Zur Traube“ ist der nachmalige Augustiner-Barfüßermönch als achtes Kind eines Gastwirts geboren worden und erhielt den bürgerlichen Namen Ulrich Megerle. In der ehemaligen Pfarrscheuer ist seit kurzem ein kleines Museum eingerichtet. Dort ist neben allgemeinen kirchlichen Ausstellungsstücken der Lebensweg von Abraham a Santa Clara anschaulich dargestellt.
Mit einem überlebensgroßen Standbild südlich der Kirche, hat die Heimatgemeinde ihren großen Sohn geehrt. Am 15. August (Mariä Himmelfahrt) des Jahres 1910 wurde dieses meisterliche Denkmal eingeweiht. Weitere Einzelheiten über Abraham a Santa Clara sind im Anhang dieser Schrift zu finden.
Die Kirche mit ihrem wuchtigen Turm ist „St. Michael“ geweiht. In die Zeit von 1778 bis 1782 datiert der heutige Kirchenbau, dessen Turm und deren Ursprünge viel älter sein dürften. Etliche Höfe im Ort sind noch in ihrem ursprünglichen Umfang und ihrer Ausgestaltung erhalten. Diese eindrucksvollen Fachwerkbauten zeugen auch heute noch von bäuerlichem Besitz und Stolz, sowie von handwerklichem Können.


Thalheim wird erstmals im Jahre 1242 urkundlich erwähnt, aus Anlaß eines Gütertausches der Klöster Wald und Reichenau. Die Gründung von Thalheim dürfte etwa im Jahre 750 als fränkische Wehrbauernsiedlung im alemannischen Scherragau erfolgt sein. Ortsherren sind die Grafen von Sigmaringen, im 13. Jahrhundert die Grafen von Helfenstein-Sigmaringen, von Montfort und das Haus Habsburg, im 14. Jahrhundert Württemberg, im 15. Jahrhundert Werdenberg und von 1535 an das Haus Hohenzollern als österreichischer Lehensträger. Im Jahre 1805 erlischt die Lehenshoheit Österreichs. Der Ort gehört fortan zum fürstlichen Oberamt Sigmaringen, wird 1023 dem Obervogteiamt Beuron und 1830 dem fürstlichen und später preußischen Oberamt Wald zugeteilt. 1861 kommt Thalheim zum Oberamt und späteren Kreis Sigmaringen.
Bereits 1275 ist Thalheim Pfarrei und gehört zum Landkapitel Laiz-Sigmaringen. Etwa um das Jahr 1740 ließ Fürst Josef Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen das sogenannte Jagdschlößchen in Thalheim erbauen. Dieses Gebäude diente zunächst wohl vorwiegend dem zuständigen Jagdaufseher. Später wurde der zweigieblige verputzte Bruchsteinbau als Pfarrhaus und auch als Kindergarten verwendet. 1983 erfuhr das stattliche Gebäude unter den neuen Eigentümern, Familie Schalk, eine grundlegende Renovierung.
Das vom hohenzollerischen Hofbaumeister Laur in den Jahren 1841/45 entworfene und erstellte Kirchplatzensemble mit Rathaus und Kirche im neugotischen Stil, sowie rechtwinkligen Achsenbezug beider Gebäude, prägt wesentlich das Bild des Ortsmittelpunktes, welchen die Thalheimer vor über 150 Jahren bewusst als Klammer zwischen Unter- und Oberdorf auf der damals noch „grünen Wiese“ neu gestaltet haben.
Auf dem Friedhof im Oberdorf steht noch der wuchtige quadratische Turm der aus dem 17. Jahrhundert stammenden ehemaligen Pfarrkirche. Er dient heute als würdige Gedenkstätte für die Gefallenen der beiden Weltkriege.
Die zwei eisernen Brunnentröge im Unter- und im Oberdorf geben noch Hinweis auf die beiden ehemals überlebenswichtigen öffentlichen Wasserplätze Thalheims aus der Zeit vor dem Anschluß an das Wassernetz der Heuberg Wasserversorgung im Jahre 1904.
Der Hl. Wendelin gilt in Thalheim als Ortspatron und auch heute noch wird seiner alljährlich am 20. Oktober mit einer feierlichen Wallfahrt gedacht. Der gute Ausgang einer Viehseuche im Jahr 1780 war Anlaß für das Gelöbnis, ihm zu Ehren einen Festgottesdienst abzuhalten. Der in den Jahren 1983/84 mit viel bürgerschaftlichem Engagement zum Versammlungs- und Festsaal damals leerstehende Farrenstall erhielt so auch den Namen Bürgerhaus St. Wendelin.
Mit der Endung -ingen gehört Leibertingen zu den Dörfern, die in der Zeit der allemannischen Landnahme (3. Jahrhundert n. Chr.) gegründet wurden. Die Höhlen an den Abhängen zur Donau waren bereits in der jungen Steinzeit (4000 – 1800 v. Chr.) menschliche Wohnstätten. Entsprechende Funde weisen auf eine Besiedlung in der Bronzezeit (1800 – 1000 v. Chr.), Grabhügel auf die Hallstattzeit (800 – 400 v. Chr.) und eine Viereckschanze auf die La Tenezeit (200 v. Chr.) hin. Urkundlich wird Leibertingen erst verhältnismäßig spät im Jahre 1275 erwähnt.
Bereits im Jahre 1567 ist in den Heiligenberger Rechnungsbüchern in Leibertingen eine Glashütte genannt. Im Jahre 1605 wird diese im Weiler Lengenfeld erwähnt, wo sie bis in die 50er Jahre des 17. Jahrhunderts bestand. Der starke Holzverbrauch dieser Glashütte hat den Charakter der Heuberglandschaft geprägt. Das Urbarmachen des Feldes für die Landwirtschaft korrespondierte mit dem Betrieb einer Glashütte. Daher wohl auch die Tatsache, daß Glashütten, nachdem das am Ort vorhandene Holz verbraucht war, an anderen Orten neu aufgerichtet wurden. Der Holzverbrauch für eine Glashütte war enorm. Für 100 kg Glas wurden etwa 100 -200 cbm Holz benötigt.
Im 17. und 18. Jahrhundert wurde auf Leibertinger Markung und in der weiten Umgebung nach Bohnerz gegraben und dieses auch teilweise im Tagebau gewonnen. Das Bohnerz wurde vorwiegend in das von 1672 – 1862 in Thiergarten betriebene Hammerwerk gebracht.
Noch im letzten Jahrhundert waren Köhler mit der Herstellung von Holzkohle beschäftigt. Nach weiteren Aufzeichnungen existierte von 1860 – 1880 in Leibertingen im heutigen Hause Xaver Knittel eine Ölmühle.
Die Leibertinger Kirche wurde, nachdem die alte entsprechend den Aussagen früherer Annalen zu klein geworden war, neu gebaut. Sie stand etwa am gleichen Platz wie die heutige, allerdings in Ost- West-Richtung. Im Jahr 1826 erfolgte unter Pfarrer Knecht die Benediktion der neuen Kirche und am 26. August 1833 wurde sie durch Weihbischof von Vikary geweiht und unter den Schutz der Apostelfürsten St. Petrus und St. Paulus gestellt.
Ganz in der Nähe der Pfarrkirche befindet sich das sogenannte „Pfarrhöfle“, wohl eines der ältesten Gebäude in Leibertingen. In seinen Ursprüngen ist es ein sogenanntes „alemannisches Bohlenständerhaus“. Nach umfangreicher Renovation ist dieses aus dem Jahr 1489 stammende Gebäude eine Bereicherung des Ortsbildes.
Zu allen Zeiten war das Geschick der Ortschaft Leibertingen eng mit der Burg Wildenstein verbunden. In einem Jahrbuch des Klosters Beuron wird diese 1077 erstmals urkundlich erwähnt. Die ersten Herren waren die Herren von Wildenstein. Mit Sicherheit darf angenommen werden, daß die günstige Lage schon früher zu einer befestigten Wohnstatt Anreiz geboten hat. Nähere Einzelheiten über die Burg sind dem Anhang zu entnehmen.
Der Weiler Lengenfeld, dessen Name und Ursprung wohl eng mit der abgegangenen Burganlage Lengenfeld in Verbindung steht, gehört seit eh und je zur Ortschaft Leibertingen. Seit dem Jahr 1724 besitzt Lengenfeld eine eigene Kapelle. Sie ist der Hl. Ottilie geweiht. Um das Jahr 1924 erwirkte Pfarrer Spitzmüller sogar die Zelebrationserlaubnis für dieses kleine Kirchlein. Der aus weißem Sandstein bestehende Altarstein stammt aus der im Jahre 1777 abgebrochenen St. Nikolaus-Kapelle im nahegelegenen ehemaligen Oberstetten. Im Dachreiter hängt eine anno 1758 gegossene kleine Glocke, die noch täglich ihre Pflicht tut.


Bürgermeister
Tatsächlich ist die Lage unserer Gemeinde, hoch über der Donau, nach Süden sanft abfallend das, was unsere Landschaft charakterisiert. Mit dem wildromantischen Donautal, im Herzen des Naturparks Obere Donau, der Jugendherberge Burg Wildenstein und dem Segelflugplatz der Segelfluggemeinschaft Leibertingen haben wir unseren Gästen vieles zu bieten.
Unsere hervorragenden Gastronomiebetriebe laden zum Verweilen ein. Sie werden sicherlich auch staunen, was es bei uns und in der näheren Umgebung alles zu erleben gibt. Mit unserem Internetauftritt wollen wir Ihnen Informationen über die Gemeinde und ihre Ortsteile bieten, über Interessantes und Aktuelles berichten.
Ich lade Sie ganz herzlich ein – besuchen Sie uns in Leibertingen und genießen Sie mit uns die Schönheit unserer Landschaft, die reichen kulturellen Schätze unserer Region oder einfach nur: das Licht, die Luft und Leibertingen.
Ihr
Stephan Frickinger, Bürgermeister
Stephan Frickinger hat an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl den Master in Public Management abgeschlossen. Ebenfalls ist er eingetragener Architekt bei der Architektenkammer Baden-Württemberg und ausgebildeter Kaufmann.
Im Mai 2021 trat er nach altersbedingtem Ausscheiden seines Vorgängers Armin Reitze dessen Nachfolge an und ist somit nach Heinrich Güntner und Armin Reitze der dritte Bürgermeister nach knapp 50-jährigem Bestehen der Gemeinde Leibertingen.
Detailliertere Informationen und Statistiken können sie über die Homepage des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg erhalten.
Dort sind über 100 nach Themen geordnete Tabellen über die Gemeinde Leibertingen zu finden.
Das interaktive Kartenverzeichnis ist ein weiteres Angebot des Statistischen Landesamtes.
Hier können Sie schnell und effektiv 90 Merkmale aus allen Bereichen der amtlichen Statistik für Leibertingen in interaktiven Karten recherchieren und mit anderen Gemeinden, Kreisen und Regionen vergleichen.
Die wichtigsten Daten zu der Gemeinde haben wir Ihnen hier zusammengestellt.
Die Gemeinde Leibertingen ist bemüht ein angenehmer Arbeitgeber zu sein.
Sie sind offen für eine neue Herausforderung? Hier finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen.
In Leibertingen erwartet Sie:
Sie haben aktuell keine passende Stellenausschreibung gefunden?
Dann kann es sein, dass wir nur noch nicht zur Veröffentlichung gekommen sind.
Trauen Sie sich und schreiben Sie uns an.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an unseren Hauptamtsleiter Herrn Siegfried Müller oder direkt an die Einrichtung.
| Mo, Di, Do, Fr | 08:30–12:00 Uhr |
| Mo (nachmittags) | 14:00–18:30 Uhr |
| Do (nachmittags) | 14:00–16:30 Uhr |
| Mo | 08:30–12:00 Uhr, 16:00–18:00 Uhr |
| Di | 08:30–12:00 Uhr |
| Mi | 09:00–10:00 Uhr |
| Do | 08:30–12:00 Uhr, 15:00–16:00 Uhr |
| Fr | 08:30–12:00 Uhr |
| Sa | 09:00–10:00 Uhr |
| Mo & Fr | 07:15–12:30 Uhr |
| Di bis Do (vormittags) | 07:15–12:30 Uhr |
| Di bis Do (nachmittags) | 13:30–16:30 Uhr |
| Mi | 17:00–18:30 Uhr (Mai – Oktober) |
| Fr | 13:30–17:00 Uhr |
| Sa | 09:00–12:00 Uhr |
Copyright © 2023 Gemeinde Leibertingen